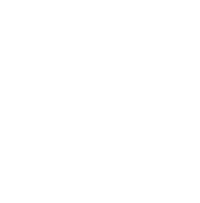Was wir wollen
Nachhaltigkeit in das Eigentums- und Wettbewerbsrecht!
Wir wollen den Deutschen Bundestag und das Europäische Parlament daran erinnern, dass die Verpflichtung des Privateigentums auf das Allgemeinwohl (Arti. 14 Abs. 2 Grundgesetz, Art. 17 Abs. 1 Satz 3 Grundrechte-Charta der EU) eine Aufforderung an den Gesetzgeber ist, diese Pflicht als Sozial- und Naturbindung auch in den Gesetzen bzw. EU-Richtlinien des Bürgerlichen Rechts und des Wettbewerbsrechts zu verankern.
Noch ist Nachhaltige Entwicklung kein vorrangiges Staatsziel
Nachhaltigkeit verlangt, dass die allgemeinen (natürlichen und sozialen) Lebensgrundlagen (BverfG: Güter der Allgemeinheit) auch für künftige Generationen verfügbar bleiben. Nach dem Verursacherprinzip müsste der, der sie nutzt, auch für ihre Erhaltung (Regeneration, Wiedergewinnung, ggf. Ersatz) sorgen, dürfte also notwendige Erhaltungskosten nicht auf sie abwälzen („externalisieren“).
Dazu steht das Eigentumsrecht in Widerspruch. Denn der Eigentümer darf mit seiner Sache nach Belieben verfahren (§ 903 BGB), also aus ihr heraus auch ungeschützte Allgemeingüter (Gemeingüter, Commons, Gemeinressourcen) ersatzlos nutzen. Schützen kann man Gemeingüter durch Zugangsbeschränkung, Nutzungsregeln, Emissionsverbote und -grenzwerte, Schonungs- und Erhaltungspflichten.
Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen (Art. 20a GG) und die Sozialpflichtigkeit des Eigentums (Art. 14.2 GG) begründen kein subjektives Recht, bedürfen gesetzlicher Regelung, und diese muss gegen das Grundrecht Eigentum abgewogen werden.
Zu einem vorrangigen Staatsziel wird Nachhaltige Entwicklung deshalb erst, wenn das Eigentumsrecht durch eine Nachhaltigkeitspflicht des Eigentums eingeschränkt wird, die als Absatz 2 in § 903 BGB (und als Abs. 3 in Art. 17 der Grundrechte-Charta der EU) eingefügt werden könnte, etwa wie folgt:
„Der Eigentümer kann allgemeine (natürliche und soziale) Lebensgrundlagen als Gemeinressourcen für seine Zwecke nutzen. Er muss aber 1. regenerierbare Gemeinressourcen (Ökosysteme, Artenvielfalt, Bodenfruchtbarkeit) schonend behandeln und dafür sorgen, dass sie sich regenerieren können, 2. abgenutzte nichtregenerierbare Gemeinressourcen (Atmosphäre, Rohstoffe) durch erneuerbare ersetzen oder durch Wiedergewinnung erneuern, 3. soziale und kulturelle Gemeinressourcen (Arbeit, Gesundheit, Bildung) vor Ausbeutung, Gefährdung, Marginalisierung schützen.“
Abs. 2 soll die Externalisierung von Kosten auf Gemeinressourcen beenden und folglich den Vorrang der endlosen Kapitalakkumulation aufheben, denn dieser wird nur durch das Privileg zur Externalisierung aufrechterhalten. Damit beseitigt die Nachhaltigkeitspflicht zugleich eine Quelle der Einkommensungleichheit.
So wird auch der Wettbewerb nachhaltig:
Wenn die Nachhaltigkeitspflicht des Eigentums nicht existiert bzw. nicht strikt befolgt wird, sparen Unternehmen durch Externalisierung Kosten und können ihre Produkte günstiger bzw. attraktiver anbieten. Das verschafft ihnen einen Marktvorteil, der als Marktleistung angesehen wird, in Wahrheit aber auf dem Verzehr von Gemeingütern beruht. Dies kommt dem rechtlichen Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs gleich, zumal es die Konkurrenten zwingt, ebenfalls Kosten zu externalisieren.
Deshalb sollte die Nachhaltigkeitspflicht des Eigentums durch das Verbot ergänzt werden, Externalisierung wie eine Marktleistung zu behandeln. In § 4 des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) sollte als Absatz 12 eingefügt werden:
(Unlauter handelt insbesondere, wer) „12. den Eindruck erweckt, ein niedriger Preis oder eine besondere Qualität oder Ausstattung eines Produkts sei auf die Marktleistung des Anbieters zurückzuführen, obwohl der Vorteil auf der Unterlassung von Aufwendungen zur Erhaltung allgemeiner Lebensgrundlagen nach § 903 Abs. 2 BGB beruht.“
Unternehmen können nach § 8 UWG von jedem Mitbewerber, von Berufsverbän-den, Kammern, Umwelt- und Verbraucherschutzorganisationen beim zuständigen Landgericht verklagt werden. Um sich gegen eine Klage nach § 4 Abs. 12 zu vertei-digen, müssten sie nachweisen, dass sie die Kosten tatsächlich internalisiert haben.
Gelingt ihnen das nicht, so können sie nach § 10 zur Herausgabe des Externalisie-rungsgewinns an den Bundeshaushalt verpflichtet werden. Geschädigte Mitbewerber können nach § 9 Ersatz des ihnen entstandenen Schadens und nach § 12 Ersatz der ihnen zur Anspruchsdurchsetzung entstandenen Aufwendungen fordern. Zudem kann das Gericht nach § 12 der obsiegenden Partei die Befugnis zusprechen, das Urteil auf Kosten der unterliegenden Partei öffentlich bekanntzumachen.
Eine flankierende Regelung sollte den Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheim-nissen nach §§ 17-19 UWG und §§ 203f StGB für diejenigen Beschäftigten des Unternehmens aussetzen, die mit Informationen dazu beitragen, dass eine Zuwiderhandlung gegen § 903 Abs. 2 aufgedeckt wird.
Die EU müsste die „Schwarze Liste“ der Richtlinie 2005/29/EU über unlautere Geschäftspraktiken im Binnenmarktverkehr um das Verschweigen der Externalisierung ergänzen.
So kann aus dem UWG ein wirksames Instrument zur Durchsetzung der Nachhaltigkeitspflicht werden. Es würde in den Markt ein Element der Allmende einfügen. Das Allmendeprinzip besteht in der durch gegenseitige Überwachung der Nutzer gesicherten Mäßigung der Ansprüche an die Gemeinressource. § 903 Abs. 2 soll die Nutzer zur Mäßigung ihrer Ansprüche verpflichten, und § 4 Abs. 12 UWG soll die Mäßigung durch gegenseitige Überwachung sichern. Im Vorfeld des Rechtsweges könnte zudem ein Ombudsman nach skandinavischem Muster eingesetzt werden.
Zur Überwachung sind Unternehmen – und ist auch die Zivilgesellschaft – besser befähigt als Behörden, denn die einen können die Kosten ihrer Konkurrenten genauer beurteilen, die andere den Schaden, der durch die Externalisierung angerichtet wird.
Konkurrierende Unternehmen beobachten einander über die nationalen Grenzen hinweg. Sie bilden ein Netzwerk, dessen Interesse an Rechtssicherheit auch die WTO davon überzeugen wird, dass erst das Verbot der Externalisierung den Wettbewerb zukunftsfähig machen wird.
Überdies würde das UWG einen Anhaltspunkt für die nach BGB anzuwendenden Sanktionen bieten, wenn ein Unternehmen einmal unmittelbar wegen Zuwiderhandlung gegen § 903 Abs. 2 BGB verklagt wird.
Doch müsste eine Anklage nach § 903 Abs. 2 wohl stets von einer Behörde kommen, wogegen das UWG es den geschädigten Konkurrenten und der Zivilgesellschaft ermöglicht, gegen die Ausnutzung eines Externalisierungsvorteils zu klagen.
[Impulsreferat von Gerhard Scherhorn im Workshop des Fortschrittsforums zum Thema „Nachhaltigkeitskriterien im nationalen Wettbewerbsrecht und EU-Recht unter Einhaltung von WTO Standards“ am 13.09.2012]